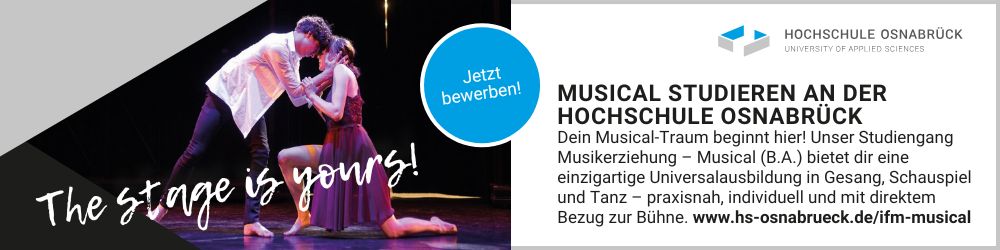Thema verfehlt: „Die Dreigroschenoper“ in Bad Hersfeld
Wenn man einen Klassiker besucht, der an sich ein Selbstläufer ist, weil Aussage, Thema und Musik bekannt sind, erwartet man nicht unbedingt, überrascht zu werden. Michael Schachermaiers Inszenierung von „Die Dreigroschenoper“ (Musik: Kurt Weill, Texte: Bertolt Brecht) in Bad Hersfeld weiß jedoch durchaus zu überraschen. Leider nicht positiv.
Das Bühnenbild (Bühne und Lichtdesign: Volker Hintermeier) ist ein chaotisches, überfülltes Durcheinander teilweise völlig unnötiger Requisiten (Doris Engel) und Versatzstücke. Es wird beherrscht von einer über der Bühne befestigten Leuchtreklame, die altmodisch für ein „Sinners Inn“ wirbt, das jedoch nie betreten wird. Es gibt an beiden Seiten der Bühne Baugerüste, links eines, davor eine Art aufgeklappter Campingwagen, in welchem die wirklich ausgezeichnete siebenköpfige Band (vor der Pause der Premiere nur fünf Musiker, weil zwei im Stau standen) untergebracht ist, rechts zwei Baugerüste, ausgestattet mit Leuchtreklame in japanischer Schrift, einem rot leuchtenden Herz und ein paar roten Glühbirnen. Davor eine bürgerliche Sitzgruppe mit beleuchtbarem Flamingo, zur Mitte hin ein großer Garderobenständer mit lumpiger Kleidung daran.
Die Mitte der Bühne wird nach hinten von einer Batterie sich langsam drehender Ventilatoren mit Scheinwerfern darin abgegrenzt, darüber schwebt der Mond von Soho. Im Vordergrund ein Tisch, der überquillt von schmutzigen Flaschen, daneben völlig sinnlos eine händeringende Lourdes-Madonna, ansonsten gibt es Klappstühle, Paletten, eine Kabeltrommel, die immerhin als Tisch und als Kanone fungieren darf, das meiste Gerümpel wird aber weder bespielt noch beachtet.
Leider sind die Baugerüste mit extrem starken Scheinwerfern bestückt, die den ganzen Abend über immer wieder – jedes Mal, wenn Mackie Messer erwähnt wird – derart grell ins Publikum blitzen und strahlen, dass empfindlicheren Menschen das Mitbringen einer Sonnenbrille anzuraten ist.
Die Kostüme (Alexander Djurkov Hotter) sind zeitlos modern, was zur „Dreigroschenoper“ durchaus passt. Jedoch tragen die Huren edle Pelze, wird der Bettler mit warmem Mantel ausgestattet, bedienen die Kostüme insgesamt das Klischee des sorglosen Sozialhilfeempfängers, wie es so gerne von einschlägigen Medien propagiert wird. Das wäre nicht weiter schlimm, würde damit im Laufe des Abends aufgeräumt, was schließlich der Intention der Vorlage entspräche, genau das passiert aber nicht. Im Gegenteil. Schrill, bunt, fröhlich, zufrieden albern sich die Protagonisten durch den Abend.
Macheath, kraftvoll verkörpert von Simon Zigah, sollte eine unwiderstehlich anziehende, schillernde, unter einer harmlos wirkenden Oberfläche extrem gefährliche Persönlichkeit sein, einer, dem ahnungslose Frauen reihenweise willig zum Opfer fallen und naiv gutgläubige Bürger problemlos auf den Leim gehen. Nicht zuletzt ist genau das Inhalt der bekannten Ballade von Mackie Messer, dessen Messer niemand sieht. Doch dieser Mackie ist eine Gangsta-Type, prollig in Joggings und Netzhemd, derart von weitem als Übeltäter zu erkennen, dass man potenziellen Opfern sagen möchte: selbst schuld.
Polly (Gioia Osthoff), laut Michael Schachermaier sich vom unschuldigen behüteten Mädchen zur Verbrecherin wandelnd, kiekst, quietscht und krächzt sich gleichbleibend durch ihre Rolle. Zum Schluss trägt sie ein weißes Business-Kostüm, woran man ihre neu erworbene Führungsqualität erkennen soll. Abnehmen mag man ihr das nicht. Ihre Interpretation des Liedes von der Piraten-Jenny berührt allenfalls unangenehm die Ohren, der eigentlich herzzerreißende Inhalt vom unerfüllten Tagtraum eines verzweifelten, verachteten Dienstmädchens verpufft wirkungslos als Lachnummer.
Götz Schulte könnte als Peachum distinguiert machtvoll eine Drückerkolonne befehlen, doch er führt seine Truppe fast väterlich als Oberhaupt einer großen glücklichen Familie, schlampt bei der Aussprache, hat Texthänger und bleibt relativ blass. Katharina Pichler gibt in ihrer Rolle als Cecilia Peachum fast schon sympathisch die komische Alte, wirkt immer leicht betrunken, vulgär und doch auch naiv.
Oliver Urbanski spielt den korrupten Polizeichef so, wie er in dieser Inszenierung leider vollkommen unglaubwürdig angelegt ist: hektisch, hilflos, irgendwie auf Droge und comichaft schurkisch. Er könnte mehr, darf aber nicht. Seine Tochter Lucy, ähnlich angelegt wie Polly, wird mit viel Energie von Laura Dittmann verkörpert. Auch sie singt wie die anderen Damen viel zu schrill oberhalb ihrer Stimmlage. Was diese Sängerinnen eigentlich drauf hätten, hört man nur in den wirklich schönen Chören.
Anna Loos lässt sich als Spelunken-Jenny nicht darauf ein und singt ihre Rolle kraftvoll, warm und berührend. Leider wirkt ihr großes Solo zu Beginn des dritten Akts, das erste Stück nach der Pause, nur dann, wenn das Publikum pünktlich auf den Plätzen sitzt. Am Premierenabend tut es das aber nicht. Ein sehr rücksichtsloser, ungehobelter Teil des Publikums findet sich reichlich verspätet wieder ein und setzt seine Pausengespräche unbeeindruckt mitten auf den Treppen des Zuschauerraums fort.
Der Abend wirf Fragen auf. Warum werden Waffen offen getragen und gezeigt, aber nie eingesetzt? Warum steht den ganzen ersten und zweiten Akt über völlig unbeachtet und nicht mit einbezogen die erwähnte Lourdes-Madonna lebensgroß auf der Bühne? Warum steckt Macheath vor der Pause in einem Käfig als Gefängniszelle, ist aber nach der Pause, erneut im selben Gefängnis, nicht in besagter Zelle, sondern frei, in ärgerlich unpassender Gekreuzigten-Pose, an deckenhohe Ketten angehängt?
Warum heiraten Macheath und Polly, wenn schon nicht im ursprünglichen Pferdestall, ausgerechnet im einzigen nicht dargestellten Bühnenbild, nämlich einer mehrfach benannten „geschwärzten Ruine“? Hätten sie nicht einfach „in einer Stiftsruine“ heiraten können? Oder, Vorschlag, in einem modernen Pferdestall, also vielleicht auf einem Schrottplatz, mit einer überdimensionierten Waschmaschine, in der währenddessen sichtbar Geld gewaschen wird? Warum sind die Gangster von heute hier keine mafiösen Anzugträger, obwohl immerhin zum Schluss eine Textzeile besagt, das Ausrauben sei womöglich das kleinere Verbrechen als das Gründen einer Bank?
Die ursprüngliche Intention der „Dreigroschenoper“ war, auf das Elend der unsichtbaren Parallelwelten hinzuweisen (die eben nicht plakativ leicht erkennbar daherkommen), Grauen zu vermitteln, ein Gespür für die tatsächlichen Missstände. Doch von Elend oder Grauen ist nichts zu spüren auf der Bühne. Kein Unbehagen stört das Wohlbefinden gut situierter Zuschauer, denn: „Solche Leute kennen wir nicht. Denen macht das Spaß so. Denen geht es gut. Und wirklich was Schlimmes passiert nicht. Was für ein schöner Abend!“
Vollkommen folgerichtig, dass vor allem der Großteil des Premierenpublikums, das sichtlich mehr auf Selbstdarstellung aus war und an völlig unpassenden Stellen bereits mit Zwischenrufen Beifall bekundete, frenetisch applaudierte. Doch ein nachdenklicherer Teil des Publikums blieb eher still. Thema verfehlt. Man kann auch einen Klassiker und Selbstläufer an die Wand fahren. Das ist den Bad Hersfelder Festspielen mit dieser Inszenierung eindrucksvoll gelungen.
Text: Hildegard Wiecker